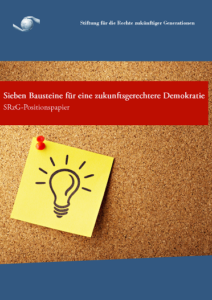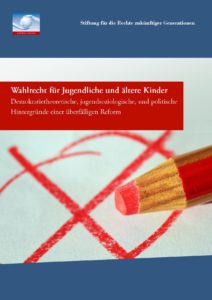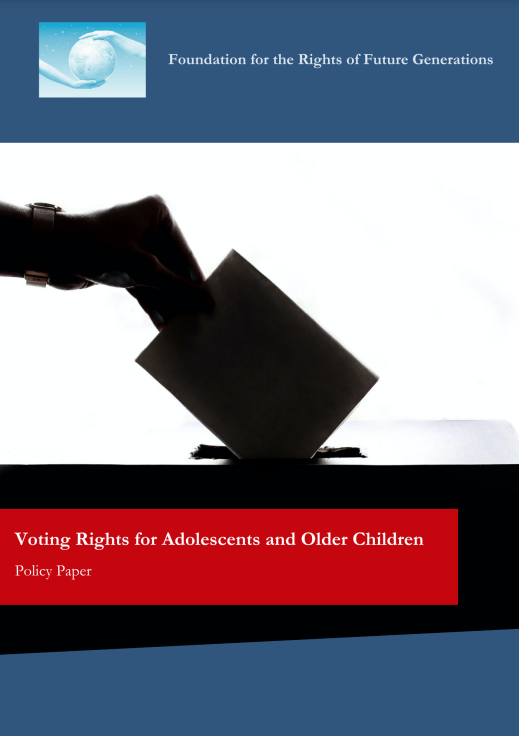Wenn Politiker wiedergewählt werden sollen, müssen sie zunächst die Interessen heutiger Generationen berücksichtigen. Dadurch wird ein falscher Anreiz gesetzt, nämlich für eine Politik der „Verherrlichung der Gegenwart und Vernachlässigung der Zukunft“ (Richard von Weizsäcker). Bei der Beschaffung heutiger Mehrheiten können die Individuen, die in Zukunft geboren werden, nicht mitwirken. Sie tauchen im Kalkül des Politikers, der seine Wiederwahl organisiert, nicht auf. Dies kann man dem einzelnen Politiker nicht zum Vorwurf machen, denn die Rahmenbedingungen selbst schreiben es ihm vor.
Wahlperioden können nicht allzu lang sein, ohne den Einfluss des Wählers zu weit zurückzudrängen und damit das Wesen der Demokratie an sich zu gefährden. Der technische Fortschritt sorgt jedoch dafür, dass die Auswirkungen gegenwärtigen Handelns weit in die Zukunft hineinreichen und die Lebensqualität zahlreicher zukünftiger Generationen tiefgreifend negativ beeinflussen können.
Könnten zukünftige Generationen ihre Interessen im politischen Entscheidungsprozess geltend machen, so wären die Mehrheitsverhältnisse bei wichtigen politischen Entscheidungen anders. Beispiel Energiepolitik: Die heutige Form der Energiegewinnung mit dem Schwerpunkt auf fossilen Energieträgern ermöglicht derzeit einen einmalig hohen Lebensstandard, nimmt aber dafür gravierende Nachteile in der mittelfristigen Zukunft in Kauf. Beispiel Finanzpolitik: Die Finanzierung heutigen Konsums durch Schulden verschiebt Lasten in die Zukunft und verringert die Freiheit kommender Politikergenerationen, selbst gestaltend Politik zu machen.
Wales ist 2016 mit der Gründung der Commission for Future Generations einen neuen Weg gegangen. Die Kommission soll die Regierung bei ihrer Arbeit beraten. Dies geschieht auf Basis des einzigartigen Well-being of Future Generations Acts, durch den die Interessen der zukünftigen Generationen gesetzlich verankert wurden. Die SRzG hat die Kommissarin Sophie Howe im März 2022 zu einem mehrstündigen privaten Austausch getroffen, darüber auf Twitter und Instagram berichtet und die Ergebnisse des Treffens in einem Blog bewertet und in einen größeren Kontext der Debatte über Zukunftsinstitutionen eingeordnet.
Das Grundgesetz bietet bislang wenig Hilfestellung, da unsere Rechtsordnung derzeit v.a. die Rechte gegenwärtiger Individuen (Rechtssubjekte) schützt. Aus diesen Gründen wird sich eine ökologisch nachhaltige bzw. generationengerechte Gesellschaft nur erreichen lassen, wenn die ökologischen Ansprüche der Zukünftigen institutionell verankert werden. Daher ist es notwendig, durch eine Veränderung des Grundgesetzes oder der Arbeitsweise des Parlaments eine Vertretung kommender Generationen zu schaffen. Gleichartige Initiativen wurden beispielsweise in Israel, der Schweiz, Ungarn bereits umgesetzt oder sind im parlamentarischen Entscheidungsprozess.
Ein wichtiger Schritt, um unsere Demokratie generationengerechter zu machen, ist die Forderung nach einem Wahlrecht für alle Bürger, also auch für ältere Kinder und Jugendliche. Die Position der SRzG zum Wahlrecht ohne Altersgrenze kann hier nachgelesen werden.
Nähere Infos auf unserer Projektseite.
Unsere Positionen
Positionspapier: Wahlrecht für Jugendliche und ältere Kinder. Demokratietheoretische, jugendsoziologische, und politische Hintergründe einer überfälligen Reform (2017)
Policy Paper: Voting Rights for Adolescents and Older Children (2024); translated and updated version of "Wahlrecht für Jugendliche und ältere Kinder"
Medienecho
- Morgenpost (16.07.2014): Kinder klagen in Karlsruhe – Dieser Junge kämpft gegen das Mindest-Wahlalter
- Stuttgarter Zeitung (15.07.2014): Wahlrecht für Jüngere. Demokratie für alle
- Spiegel Online (15.07.2014): Wahlrecht für Minderjährige – Auch eine elfjährige hat eine Meinung
- Süddeutsche Zeitung (14.07.2014): „Wir wollen wählen“
- Spiegel Online (13.07.2014): Beschwerde über Mindestwahlalter – Kinder ziehen vor Bundesverfassungsgericht
- taz (13.07.2014): Wahlrecht in Deutschland – Kinder an die Urnen
- der Freitag (12.08.2013): Generationengerechtigkeit? Herrschaft der Alten
Externe Informationen
- Verfassungsgarantie der Generationengerechtigkeit
erschienen in der Reihe „Der aktuelle Begriff“ der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags - Handbook of Intergenerational Justice
Autoren aus Frankreich, Israel, Ungarn und Malta schildern, wie ihre Länder Generationengerechtigkeit institutionell verankert haben - Changing the German Constitution in Favor of Future Generations – Four Perspectives from the Young Generation
Vier Bundestagsabgeordnete schildern, wie sie Generationengerechtigkeit in der Verfassung verankern wollen