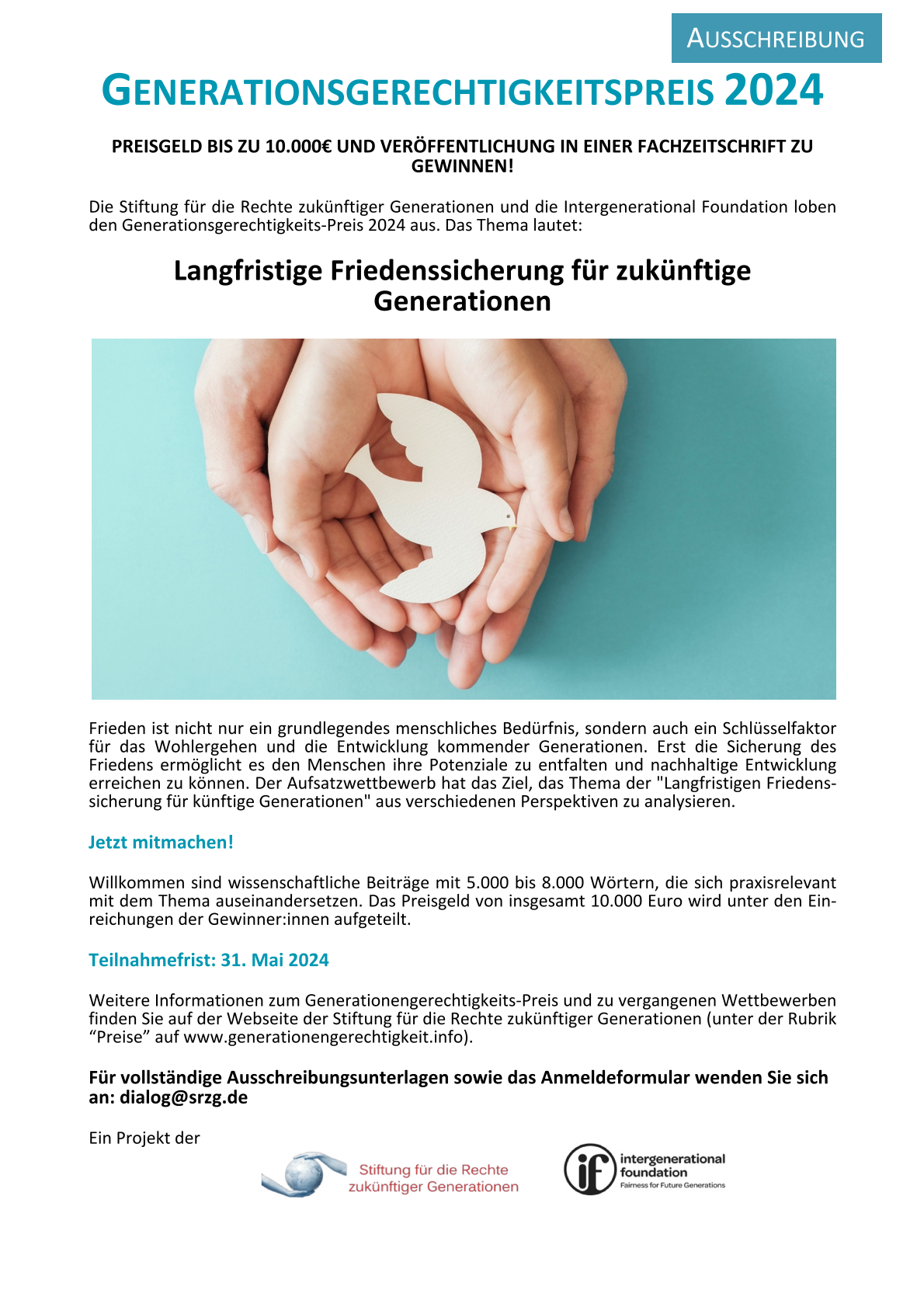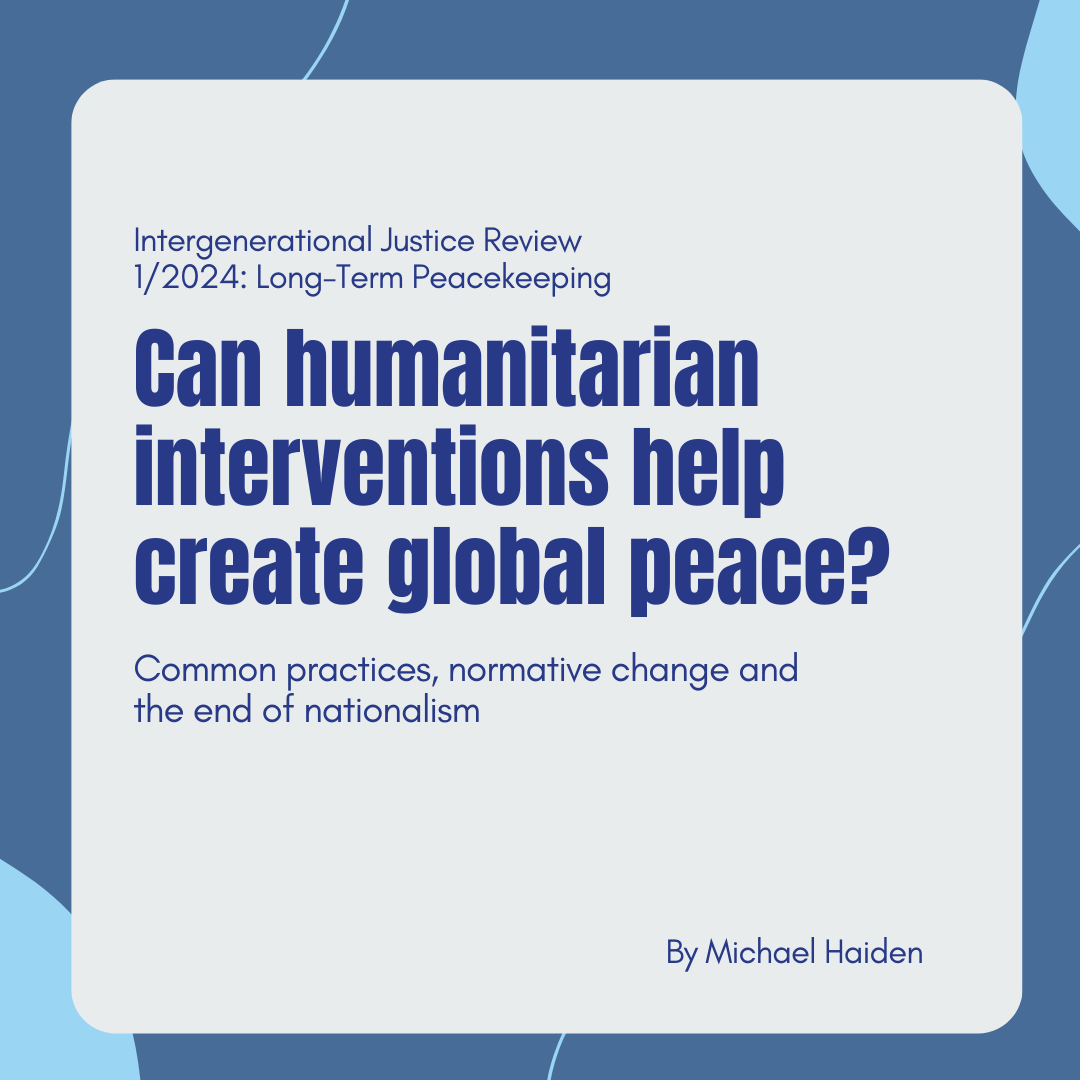Der Generationengerechtigkeits-Preis wird von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen gemeinsam mit der britischen Intergenerational Foundation an Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Fachrichtungen verliehen, um (insbesondere junge) Forschung zu Generationengerechtigkeit zu fördern. Der Preis wird im zweijährigen Rhythmus zu wechselnden Themen ausgeschrieben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Preis wurde von der Stiftung Apfelbaum initiiert, die auch das Preisgeld finanziert. Ziel des Generationengerechtigkeits-Preises ist es, die Diskussion um eine generationengerechte Politik zu fördern, ihr eine wissenschaftliche Grundlage zu verleihen und den Entscheidungsträgern Handlungsperspektiven zu eröffnen. Wir möchten vor allem Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen bis 35 Jahre zur Teilnahme ermutigen; eine Altersbeschränkung gibt es allerdings nicht.
Aktueller Wettbewerb
In den nächsten Wochen wird der Generationengerechtigkeits-Preis für die Jahre 2025/26 ausgeschrieben – die Bekanntgabe erfolgt zeitnah über unseren Newsletter sowie auf Instagram und LinkedIn!
Vergangene Wettbewerbe
2015/16
Der Generationengerechtigkeitspreis 2024
"Langfristige Friedenssicherung für zukünftige Generationen"
Frieden ist nicht nur ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, sondern auch ein Schlüsselfaktor für das Wohlergehen und die Entwicklung kommender Generationen. Erst die Abwesenheit von Krieg ermöglicht eine Umgebung, in der Menschen ihre Potenziale entfalten können. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Lebensqualität und Zukunftschancen der kommenden Generationen. Kriege und gewaltsame Konflikte haben verheerende Folgen für die Gesellschaft. Sie führen zum Verlust von Leben und Gesundheit, zerstören Gemeinschaften und Infrastruktur, unterbrechen sozialen Fortschritt und hinterlassen oft langfristige Traumata.
Mit dem Besitz von Atomwaffen hat die Menschheit erstmals in ihrer Geschichte selbst die Mittel in der Hand, um ihrem Fortbestehen ein Ende zu setzen. Der Krieg in der Ukraine und die immer weiter zunehmenden Spannungen rund um Taiwan haben den Einsatz von Atomwaffen so wahrscheinlich werden lassen wie nie zuvor. Die Menschheit kann es sich nicht leisten, auf nukleare Abschreckung zu setzen: Der derzeitige Umgang mit Atomwaffen ist nicht zukunftsfähig. Ihr Einsatz führt nicht nur zur unmittelbaren Vernichtung von Menschenleben und Infrastruktur, sondern hat auch langfristige Folgen für die Umwelt. Darüber hinaus erfordern die Instandhaltung und Modernisierung von Atomwaffenarsenalen erhebliche finanzielle Mittel. Diese Ressourcen könnten stattdessen in Bildung, Gesundheitsversorgung, Armutsbekämpfung und in den Klimaschutz investiert werden, um den Bedürfnissen der heutigen und zukünftigen Generationen gerecht zu werden.
Die Sicherung langfristigen Friedens erfordert Maßnahmen auf individueller, lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Dazu gehören der Aufbau von Vertrauen und die Förderung des Dialogs zwischen den Nationen, die Zusammenarbeit bei der Konfliktprävention und -lösung, die Stärkung von Institutionen für Frieden und Gerechtigkeit, die Förderung der Menschenrechte und die nachhaltige Entwicklung.
Die Jury 2024
Dr. Mathew George
Leiter des Arms Transfers Programme am Internationalen Stockholmer Institut für Friedensforschung (SIPRI)
Prof. Dr. Gerald Kirchner
Leiter des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung (ZNF) der Universität Hamburg
Prof. Dr. Dr. Christian Reuter
Fachbereich Informatik an der TU Darmstadt, Vorsitz Science and Technology for Peace and Security (PEASEC)
Prof. Dr. Michal Smetana
Institute of International Studies an der Karls-Universität Prag, Leiter des Peace Research Center Prague
Elena K. Sokova
Geschäftsführerin des Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP)
Prof. Dr. Conrad Schetter
Direktor des Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC)
Prof. Brian Toon
Fachbereich für Atmosphären- und Ozeanwissenschaften und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am LASP der University of Colorado
Prof. Dr. Herbert Wulf
Senior Fellow am BIIC und Senior Associate Fellow am Institute for Development and Peace (INEF)
Die Preisträger:innen 2024
Die eingesandten Forschungsarbeiten und Artikel wurden von der siebenköpfigen Jury im Doppelblindverfahren bewertet. Die Jury hat sechs wissenschaftliche Arbeiten von Nachwuchswissenschaftler:innen ausgezeichnet. Das Preisgeld von 10.000€ wurde unter dem Erstplatzierten und den gleichrangig bewerteten nächstplatzierten Preisträger:innen aufgeteilt.
Lukas Kiemele, Universität Freiburg
'Challenges and prospects for long-term peacekeeping in the Anthropocene'
Augustine Akah, Universität Kiel und Brian Chaggu, Marie Curie Sklodowska Universität
'Towards a Long-term Peace Approach: A Phenomenological Analysis of Contemporary and Emerging Conflicts'
Ibrahim Khan, University of Chicago
'Transforming Global Governance: Toward Sustainable Peace and Justice'
Luzie Krüger, Universität Bremen
'Langfristige Friedenssicherung durch Modernitätsverlust'
Rojeh Gharfeh, Hebrew University of Jerusalem
'Philosophical Foundations and Future Threats: Understanding Political Manipulation Impact on Democratic Principles and Securing Democratic Principles for Future Generations in the Digital Age'
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2022
"Existenzielle und unbekannte Risiken für zukünftige Generationen"
Unter existenziellen Risiken versteht man alle potenziellen Gefahren, die die Menschheit zerstören oder sie ihres Potenzials berauben könnten. Dafür muss die Menschheit nicht aussterben, es würde schon reichen, wenn sie einen unumkehrbaren Kollaps ihrer Zivilisation erleiden würde, oder wenn sie nicht mehr frei über ihr eigenes Schicksal verfügen könnte. Solche Risiken können sowohl menschlichen, als auch natürlichen Ursprungs sein – sie können uns auch heute noch unbekannt sein.
Was den Umgang mit existenziellen bzw. jetzt noch unbekannten Risiken besonders schwer macht, ist, dass wir noch keine Erfahrungen mit ihnen sammeln konnten. Wir haben das Gefühl, dass existenzielle Risiken nie oder jedenfalls nicht in unserer Lebensspanne eintreten werden.
Wie mit diesen (und anderen) Risiken in der Gegenwart und für die Zukunft umgegangen wird, ist eine zentrale Frage für die Menschheit. Darüber herrschte Einigkeit unter den vielen Nachwuchswissenschaftler:innen, die sich am Generationengerechtigkeits-Preis 2022 beteiligt hatten. Die eingesandten Forschungsarbeiten und Artikel waren dann von der sechsköpfigen Jury im Doppelblindverfahren bewertet worden. Die Jury hat fünf wissenschaftliche Arbeiten von Nachwuchswissenschaftler:innen ausgezeichnet.
Die mit dem Generationengerechtigkeits-Preis 2022 gekürten Arbeiten zeigen, wie komplex – vor allem menschengemachte – existenzielle Bedrohungen und Risiken sind. Die Autorenschaft macht klar: es kann nicht auf morgen verschoben werden, diese Bedrohungen zu bekämpfen. Existenzielle Risiken müssen verhindert werden.
Die Preisträger:innen 2022
1.
Marina Moreno
Does Longtermism Depend on Questionable Forms of Aggregation?
2.
Christoph Herrler
How to Cope with Nightmares: Menschenrechte und existenzielle Risiken für zukünftige Generationen
3.
Johannes Kattan
Extinction risks and resilience: A perspective on current existential risks research with nuclear war as an exemplary threat
4.
Dominik Koesling und Claudia Bozzaro
The post-antibiotic era: an existential threat for humanity
5.
Augustine Ugar Akah
Existential and Unknown Risks for Future Generations: Trends and analysis
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2020
Intergenerationelle Vermögenstransfers durch Erbschaften und Schenkungen
Vermögenstransfers über Generationen hinweg verbinden Gerechtigkeit zwischen früheren, heutigen und zukünftigen Generationen (intergenerationelle Gerechtigkeit) mit der Gerechtigkeit innerhalb der heutigen Generation (intragenerationelle Gerechtigkeit). Ein wesentlicher Grund für die zunehmende Ungleichheit in einer Gesellschaft ist die Vermögenanhäufung innerhalb von Familien im Zeitverlauf. Dabei gibt es ein Instrument, welches diesen Effekt abschwächen könnte: die Erbschaftssteuer.
Sie entzieht den Erblassern mehr oder weniger stark die Möglichkeit, ihr Vermögen an die jeweiligen direkten Nachkommen weiterzugeben. Beim Tod einer Person würde demnach das zu vererbende Vermögen nicht direkt an die Familienmitglieder gehen, sondern vom Staat an alle Bürger*innen ausgezahlt werden. Einer möglichen Erbschaftssteuervermeidung durch Schenkungen vor Eintritt des Todes kann der Staat mit einer Schenkungssteuer begegnen. Beide Steuerarten sind politisch freilich hoch umstritten.
Vererben (und schenken) als „philosophisches Problem“ entsteht erst, wenn die Eigentumsrechte individualisiert werden. Auf der einen Seite wird die Auffassung vertreten, dass die Akzeptanz von Privateigentum impliziere, dieses auch in Familienverhältnissen zuzulassen: Reichtum dürfe sich entlang der Familienlinien sammeln, anstatt bei jedem Generationenwechsel auf die Gesellschaft als Ganzes umverteilt zu werden. Nach dem gegenteiligen Standpunkt sollte die Geburtslotterie (die Frage, ob man in eine arme oder reiche Familie geboren wird) keinen Einfluss auf die Lebenschancen der Mitglieder der jüngsten Generation haben. Das Erbrecht sei abzulehnen, weil es den Erbenden unverdientes und müheloses Einkommen ermögliche und die relativen Chancen familiär-finanziell Unterprivilegierter schmälere.
Die Preisträger:innen 2020
Oscar Stolper und Lukas Brenner
Mind the gap: inheritance and inequality in retirement wealth
Ann Mumford, Martin Eriksson und Asa Gunnarsson
Capital on the moral continuum: the UK, Sweden, and the taxation of inherited wealth
Johannes Stößel, Sonja Stockburger und Julian Schneidereit
Inheritances and Gifts: Possibilities for a fair taxation of intergenerational capital transfers
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2017/18
"Wie attraktiv sind Gewerkschaften und Parteien für junge Menschen?"
Europaweit kämpfen Parteien und Gewerkschaften mit sinkenden Mitgliederzahlen. Dieser generelle Rückgang scheint die jüngeren Jahrgänge verhältnismäßig mehr zu betreffen—nicht weil sie verstärkt austreten, sondern weil sie seltener in Parteien und Gewerkschaften eintreten. Die Folgen sind ein Altersproblem und eine ungerechte Verteilung politischen Einflusses zwischen den lebenden Generationen. Im internationalen Vergleich finden sich aber auch Erfolgsgeschichten. Warum gelingt es einigen Organisationen weitaus besser, das Interesse junger Menschen an einem Engagement und einer Mitgliedschaft zu wecken?
Die Preisträger:innen 2018
1.
Mona Lena Krook und Mary Nugent
Not Too Young to Run? Age Require-ments and Young People in Elected Office
2.
Philipp Köbe
Wie politische Organisationen für junge Erwachsene attaktiver werden können
3.
Thomas Tozer
Is there a sound democratic case for raising the membership of young people in political parties and trade unions through descriptive representation?
3.
Aksel Sundström und Daniel Stockemer
Youth representation in the European Parliament: The limited effect of political party characteristics
5.
Emilien Paulis
What’s going around? A social network explanation of youth party membership
Die Jury bestand aus Prof. Dr. Ann-Kristin Kölln (University Aarhus, Dänemark), Prof. Dr. Susan E. Scarrow (University of Houston, USA), Prof. Dr. Matt Henn (Nottingham Trent University, GB), Prof. Dr. Jan van Deth (Universität Mannheim, Deutschland), Dr. Kate Dommett (University of Sheffield, GB), Dr. Craig Berry (Manchester Metropolitan University, GB) und Dr. Bettina Munimus (ehemals SRzG).
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2015/16
"Verfassungen als Ketten"
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2015/16 beschäftigte sich mit Spannungsverhältnis zwischen flexiblen und unflexiblen Verfassungen – zwischen Rigidität bis hin zu Ewigkeitsklauseln und Flexibilität bis hin zu automatischen Verfallsdaten.
Verfassungen sind per se intergenerationelle Verträge, denn sie beanspruchen die Gültigkeit über mehrere Generationen hinweg. Wenn Verfassungen zu rigide oder gar unveränderlich sind, so verhindern sie das Selbstbestimmungsrecht jeder nachwachsenden Generation. Sind sie zu leicht zu ändern, so droht Instabilität, die ebenfalls negative Auswirkungen für nachwachsende Generationen haben kann. Das Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Polen – zwischen Rigidität bis hin zu Ewigkeitsklauseln und Flexibilität bis hin zu automatischen Verfallsdaten – war Gegenstand des Aufsatzwettbewerbs.
Die Preisverleihung fand am 8. November 2016 im Rahmen des Demografie-Kongresses „Best Age“ in Berlin statt.
Die Preisträger:innen 2016
1.
Konstantin Chatziathanasiou
Verfassungen als Ketten? Zur intergenerationellen Herausforderung der Verfassungsgebung
1.
Inigo Gonzalez-Ricoy
Legitimate Intergenerational Constitutionalism
3.
Michael Rose
Constitutions, Democratic Self-Determination and the Institutional Empowerment of Future Generations: Mitigating an Aporia
3.
Shai Agmon
Could Present Laws Legitimately Bind Future Generations? A Normative Analysis of Jefferson’s Proposal
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2013/14
"Jugendbewegungen für Generationengerechtigkeit"
Die späten 1960er Jahre waren geprägt durch die 68er Generation, eine radikale, weitverbreitete Jugendbewegung. Die Kinder (und Enkel) der 68er zeigten jedoch deutlich weniger politisches Engagement. Sie wurden daher wiederholt als egoistisch, träge und a-politisch charakterisiert. Nun scheint eine Veränderung stattzufinden: Weltweit gehen junge Menschen auf die Straße und verschaffen sich Gehör. Die neuen Jugendproteste reichen von Bildungsstreiks und Klima-Aktivismus über die Occupy-Bewegung und die spanische Bewegung „¡Democracia Real YA!“ bis hin zum Arabischen Frühling und dem jüngsten Aufstand auf dem Taksim-Platz in Istanbul.
Gegenwärtig ist Europa, was Jugendbewegungen anbelangt, ein Kontinent der Kontraste. Trotzdem gibt es ein gemeinsames Thema das sich quer durch Europa zieht: Weder sind die jungen Menschen schlagkräftig organisiert, noch haben sie eine starke Lobby, die ihre Interessen vertritt. Es ist fragwürdig, ob Dachverbände für die Interessen von jungen Generationen – wie der Bundesjugendring oder das britische British Youth Council – eine ähnliche integrative Rolle spielen können, wie es bewährte Interessengruppen älterer Generationen in ihren betreffenden Ländern vermögen.
Das Durchschnittsalter von Partei- und Parlamentsmitgliedern steigt stetig an; junge Politiker sind rar. Aber wo etablierte Parteien scheitern, können sich junge Menschen manchmal zu Protesten zu Themen und Angelegenheiten, die sie direkt betreffen – wie Kürzungen im Bildungssystem, hohe Jugendarbeitslosigkeit und die allgemeine Perspektivenlosigkeit – mobilisieren.
Was macht Jugendbewegungen aus? Welche Interessen junger Menschen führen zu politischen Protesten oder Aktionen? Und welche Rolle spielt die Motivation der Generationengerechtigkeit?
All diesen Fragen widmeten sich die Wettebwerbsbeiträge.
Die Preisträger:innen 2014
1.
Miriam Stehling und Merle-Marie Kruse
Occupy als Jugendbewegung für Generationengerechtigkeit? Mediatisierte Aushandlungen des „Politischen“ durch junge Menschen
2.
Sonja Thau
Der Arabische Frühling als Ruf für Generationengerechtigkeit
3.
Thomas Tozer
Youth Movements for Intergenerational Justice A study into the nature, cause and success of youth movements, and why they are required by intergenerational justice and democracy
Sonderpreise
- Anna Braam: Die Occupy-Bewegung im Lichte der Generationengerechtigkeit
- Paul Schulmeister: Strukturelle und ideologische Unsicherheiten der Jugendgeneration. Dynamiken und Brüche bei Jugendbewegungen
- Marlene Heinrich und Marion-Christine Totter: Movimiento Multicolorido (Bunte Bewegung). Die Bewegung 15-M und ihr Versuch einer gerechten Welt
- Christiane Hoth: Die „Generation Y“ und der movimiento estudiantil in Chile
- Mie Scott Georgsen: Contentious Youths? A Case Study on The Gezi Park Protests and the Maidan Uprising
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2011/12
"Die Schuldenbremse in Deutschland - Evaluation im nationalen und internationalen Kontext"
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2011/12 beschäftigte sich mit neuen im Grundgesetz verankerbaren Schuldenbegrenzungsregeln vor dem Hintergrund einer generationengerechten Finanzpolitik.
Viele Jahre war die wirksame institutionelle Begrenzung der Staatsverschuldung eine Streitfrage im Diskurs um eine nachhaltige Finanzpolitik und eine Kernforderung der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Am Ende war es die Explosion der Neuverschuldung in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise, die eine „Schuldenbremse“ mehrheitsfähig machte: Im Frühjahr 2009 beschlossen Bundestag und Bundesrat mit der Föderalismusreform II weitreichende Änderungen im deutschen Staatsschuldenrecht, deren Herzstück die Verankerung des Grundsatzes eines strukturell ausgeglichenen Haushalts ist. Eine umfassende Bewertung der Reform, insbesondere ihrer Umsetzung, wird erst möglich sein, wenn die Übergangsregelungen ausgelaufen und die ersten Bundes- und Landeshaushalte verabschiedet sind. Wir möchten eine erste Zwischenbilanz ziehen und die Schuldenbremse zum Thema einer interdisziplinären wissenschaftlichen Betrachtung machen.
Die Preisträger:innen 2012
1.
Heiko Burret
Die Deutsche Schuldenbremse als Panazee? – Eine Analyse im historischen Kontext
2.
Lea Grohmann
Generationengerechte Finanzpolitik im Bundesstaat – ohne Aussicht auf Erfolg
Preisverleihung und Symposium
Anlässlich der Preisverleihung des 6. Generationengerechtigkeits-Preises fand am 3. November 2012 ein Symposium in den Räumlichkeiten der GLS-Bank in Stuttgart statt. Das Thema des Preises sowie des Symposiums war: „Die Schuldenbremse – Evaluation im nationalen und internationalen Kontext“. Im Anschluss an die Preisverleihung fanden zwei Workshops statt, welche nochmals die Thesen der Siegerarbeiten aufgriffen. Die Moderation des ersten Workshops zur Arbeit von Heiko Burret übernahm Dr. Ed. Turner, Dozent für Politikwissenschaft an der Aston University in England. Der zweite Workshop wurde von Dr. Gisela Meister-Scheufelen, Kanzlerin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, moderiert. In den Workshops konnten die Teilnehmer des Symposiums ihre Sicht zum Thema Schuldenbremse sowie den Hauptthesen der Siegerarbeiten äußern. Die Workshops waren geprägt von spannenden Diskussionen und der Erörterung möglicher Probleme bei der Umsetzung der Schuldenbremse.
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2009/10
"Möglichkeiten und Grenzen kooperativer Problemlösungen in der deutschen Parteienlandschaft"
Die Entscheidungsfindung im politischen System Deutschlands ist komplex. Schon die Koalitionspartner in einer Mehrparteienregierung vertreten mit Blick auf die nächsten Wahlen parteipolitische Eigeninteressen. Bei entsprechenden Mehrheitsverhältnissen wird die Opposition zum Vetospieler im Bundesrat. Die Verflechtung von Bundes- und Landeskompetenzen er-möglicht eine parteipolitisch motivierte Blockade, auch über Medien, Verbände und Gewerkschaften können Parteien gegen geplante Entscheidungen mobilisieren. Vor allem finanzielle Einschnitte und langfristig angelegte Investitionen fallen der Parteienkonkurrenz zum Opfer: Kurzfristig scheint es nicht rational, die Verantwortung für unpopuläre Entscheidungen (mit-) zutragen, sondern erstrebenswert, die eigene Partei als Vertreter der Partikularinteressen der Wählerschaft zu profilieren. Diese Mechanismen verhindern bisweilen eine sachorientierte Zusammenarbeit. Das Ausbleiben von – kostspieligen – Reformen im Bildungssystem oder die Aufgabe von Klimaschutzzielen zugunsten einer Förderung rückständiger Industrien sind Beispiele, die illustrieren, dass häufig zukunftsorientierte Maßnahmen von einzelnen Parteien blockiert werden. Insbesondere zukünftige und nachrückende Generationen werden also durch fehlende sachorientierte Zusammenarbeit der Parteien benachteiligt. Wie kann eine solche Kooperation der Parteien gefördert und „Opposition um der Opposition willen“ eingedämmt werden?
Die Preisträger:innen 2010
1.
Eike-Christian Hornig
Bedingungen generationengerechter Politik in der deutschen Parteiendemokratie – Formen direkter Demokratie als Blockadelöser?
2.
Mathias König und Wolfgang König
Deliberative Governancearenen. Die Überwindung kooperativer Problemlösungen in der deutschen Parteiendemokratie
2.
Volker Best
Dem Parteienwettbewerb die Beuteorientierung nehmen –Plädoyer für eine Direktwahl der Minister
Preisverleihung
Am 23. März 2011 fand in den Räumen der Landesvertretung Sachsen-Anhalt beim Bund die Verleihung des Generationengerechtigkeits-Preises statt. Nach Grußworten des Dienststellenleiters der Landesvertretung, Frank Smeddinck und des Pressesprechers der SRzG, Wolfgang Gründinger, hielt Prof. Dr. Uwe Jun von der Universität Trier die Laudatio auf die Preisträger. Als Mitglied der Jury war er mit den Thesen der Preisträger vertraut und führte in deren Lösungsansätze ein. Danach stellten die Preisträger ihre Arbeiten den Symposiumsteilnehmern vor. Im Anschluss an die Preisverleihung fand eine Podiumsdiskussion mit dem Thema “Dauerwahlkampf oder notwendiger Parteienwettbewerb? Wo liegen die Chancen und Grenzen sachorientierter Politik?“ statt, an der vier Abgeordnete des Deutschen Bundestages teilnahmen: Florian Bernschneider (FDP), Kai Gehring (MdB Bündnis90/Die Grünen), Jutta Krellmann (MdB Die Linke), Dr. Philipp Murmann (MdB CDU/CSU).

Der Generationengerechtigkeits-Preis 2007/08
""Generation P" - Ungleichbehandlung von Jung und Alt in der Arbeitswelt"
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2007/08 beschäftigte sich mit der Beziehung zwischen Generationengerechtigkeit und Gerechtigkeit in der Entlohnung, den Veränderungen der Arbeitswelt generell und Auswirkungen auf die verschiedenen Jahrgänge, der Situation der jüngeren Generation in der Arbeitswelt im internationalen Vergleich sowie Lösungen auf gesellschaftlicher, betrieblicher und individueller Ebene.
Die Preisträger:innen 2008
1.
Felipe Temming
Generation P – Ungleichbehandlung von Jung und Alt in der Arbeitswelt
1.
Wolfgang Gründinger
Die prekäre Generation – Zur Benachteiligung der jungen Generation auf dem Arbeitsmarkt
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2005/06
"Generationengerechtigkeit und Wahlrecht von Geburt an"
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2005/2006 behandelte das Thema „Wahlrecht von Geburt an“. Hintergrund der Ausschreibung war der Ausschluss vom Wahlrecht von rund einem Fünftel der deutschen Bevölkerung. Gerade im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel stellt sich somit die Frage, ob die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien in der Politik noch angemessen repräsentiert sind. Das Thema sollte interdisziplinär, u.a. aus politikwissenschaftlicher, juristischer, historischer und soziologischer Sicht, betrachtet werden. Zu den Fragestellungen gehörten: Erfordert das Demokratieprinzip ein „Wahlrecht von Geburt an“? Welche Modelle und Verfahren sind denkbar? Fördert ein „Wahlrecht von Geburt an“ die Verwirklichung von Generationengerechtigkeit? Welche gesellschaftlichen Widerstände und Vorbehalte gegen ein „Wahlrecht von Geburt an“ sind zu erwarten und wie können sie konkret überwunden werden?
Die Preisträger:innen 2006
1.
Wolfgang Gründiger
2.
David Krebs
3.
Ines Brock
Albrecht Mangler und Stephan Hahr
Dr. Tim Krieger
Die Beiträge wurden im Sammelband „Wahlrecht ohne Altersgrenze?“ sowie in der Ausgabe 3/2006 der GenerationenGerechtigkeit! veröffentlicht.
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2003/04
"Generationengerechtigkeit als Leitbild für Unternehmen"
Betriebsrenten, Ausbildungsplatzabgabe, Jugendarbeitslosigkeit und das Zurückdrängen der Solidargemeinschaft sind Schlagwörter, mit denen man tagtäglich durch die Medien konfrontiert wird. In diesem Zusammenhang gewinnt der Begriff der „Generationengerechtigkeit“ immer mehr an Bedeutung. Um so erstaunlicher ist es auf der anderen Seite, dass gerade der Themenkomplex der „generationengerechten Unternehmenspolitik“ gegenwärtig noch ein Schattendasein fristet und das, obwohl transnationale Unternehmen im Rahmen der Globalisierung zu immer wichtigeren Akteuren werden.
Die folgenden Fragestellungen sollten behandelt werden: Inwieweit ist Generationengerechtigkeit eine Aufgabe von Unternehmen? Welche Instrumente und Modelle zur Implementierung von Generationengerechtigkeit in Unternehmen gibt es (z.B. Initiativen in Unternehmen und Wirtschaft, staatliche Steuerungsinstrumente, Einflussmöglichkeiten weiterer Akteure)? Inwieweit haben sie sich bewährt? Welche Alternativen gibt es?
Die Preisträger:innen 2004
1.
Jan-Marek Pfau
2.
Frauke David, Oliver Falck, Stephan Heblich und Christoph Kneiding
Die Beiträge wurden im Sammelband „Unternehmensleitbild Generationengerechtigkeit“ und in Ausgabe 1/2005 der GenerationenGerechtigkeit! veröffentlicht.
Der Generationengerechtigkeits-Preis 2001/02
"Wie kann ökologische Generationengerechtigkeit im Grundsatz stärker verankert werden als bisher?"
Der erste Generationengerechtigkeits-Preis 2001/2002 beschäftigte sich mit der Fragestellung „Wie kann ökologische Generationengerechtigkeit im Grundgesetz stärker verankert werden als bisher?“. Hintergrund der Ausschreibung war die ungeklärte Vertretung der künftigen Generationen in der deutschen Demokratie. Das Grundgesetz definiert nur die Rechte der bereits Geborenen, also der heute lebenden Generationen. Der Schutz des Grundgesetzes wirkt nicht in die Zukunft. Es ist ethisch nicht vertretbar, wenn heute lebende Generationen die ökologischen und ökonomischen Ressourcen des Landes aufbrauchen, so dass für spätere Generationen nichts mehr übrig bleibt. Deshalb ist es notwendig, die gefährdeten Rechte nachrückender Generationen durch eine Weiterentwicklung des Grundgesetzes zu garantieren.
Der Wettbewerb stand unter Schirmherrschaft der Bundesministerin der Justiz, Frau Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, die den drei Gewinnern des Wettbewerbs ein Praktikum im Bundesministerium der Justiz anbot.
Die Preisträger:innen 2002
1.
Doris Armbruster
Anemon Bölling
2.
Dr. Johannes Rux
Die Beiträge wurden in gekürzter Fassung im „Handbuch Generationengerechtigkeit“ veröffentlicht.