Der Demografiepreis wurde zwischen 2006/2007 und 2019 von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen gemeinsam mit der britischen Intergenerational Foundation an Nachwuchswissenschaftler/innen verliehen, um junge Forschung über den demografischen Wandel zu fördern. Der Preis war von der Stiftung Apfelbaum inspiriert worden, die auch das Preisgeld auslobte. 2019 stellte die SRzG die Vergabe des Demografie-Preises ein; sie verleiht aber weiterhin alle zwei Jahre den Generationengerechtigkeits-Preis.
Vergangene Wettbewerbe
Demografie-Preis 2019
„Wohnungskrise: Wie können wir die Situation für junge Menschen verbessern?“

In vielen europäischen Ländern ist bezahlbares Wohnen ein drängendes Thema, insbesondere in Großstädten und Universitätsstädten. In der Debatte um Wohneigentum, Mietpreiserhöhungen oder Mietpreisbremsen wird oft vergessen, dass die verschiedenen Generationen unterschiedlich betroffen sind. Steigende Miet- und Kaufpreise erschweren speziell jungen Menschen den Zugang zum Wohnungsmarkt.
Was oft als „Wohnungskrise“ bezeichnet wird, kann als Frage der Generationengerechtigkeit gesehen werden, denn die Babyboomer hatten leichteren Zugang zu Wohnungen oder deren Finanzierung. Heute profitiert diese Generation zweierlei: mit Immobilienwerten und Mieteinnahmen. Die heutige Nachfrageerhöhung führt zu weiterem Druck auf den Wohnungsmarkt, insbesondere im Niedrigpreissegment.
In vielen Ländern ist Eigentum an Immobilien zu einer größeren Quelle der Wohlstandsungleichheit zwischen den Generationen geworden als das Lohngefälle. Ein Vergleich innerhalb der EU zeigt deutliche Unterschiede bei der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für die nächste Generation. Internationale Beispiele belegen, dass erfolgreiche Wohnungspolitik möglich ist. Die Einreichungen beschäftigten sich, mit Verbesserungen für dieses Problem.
Die Jury 2019
Lindsay Flynn
Wheaton College, MA – juror and guest editor to IGJR
Kim McKee
University of Stirling – juror
Elena Lutz
ETH Zürich and FRFG – juror
Antony Mason
IF – IGJR copy editor
Jörg Tremmel
University of Tübingen – IGJR editor
Maria Lenk
FRFG – IGJR editor
Die Preisträger:innen 2019
Veronika Riedl
mit ihrer Einreichung Right to housing for young people: On the housing situation of young Europeans and the potential of a rights-based housing strategy
Hier lesen
Laura Naegele, Wouter De Tavernier, Moritz Hess und Sebastian Merkel
mit ihrer Einreichung Do young people stand alone in their demand to live alone? The intergenerational conflict hypothesis put to test in the housing sector
Hier lesen
Demografie-Preis 2016/17
„ Generationengerechtigkeit messen“
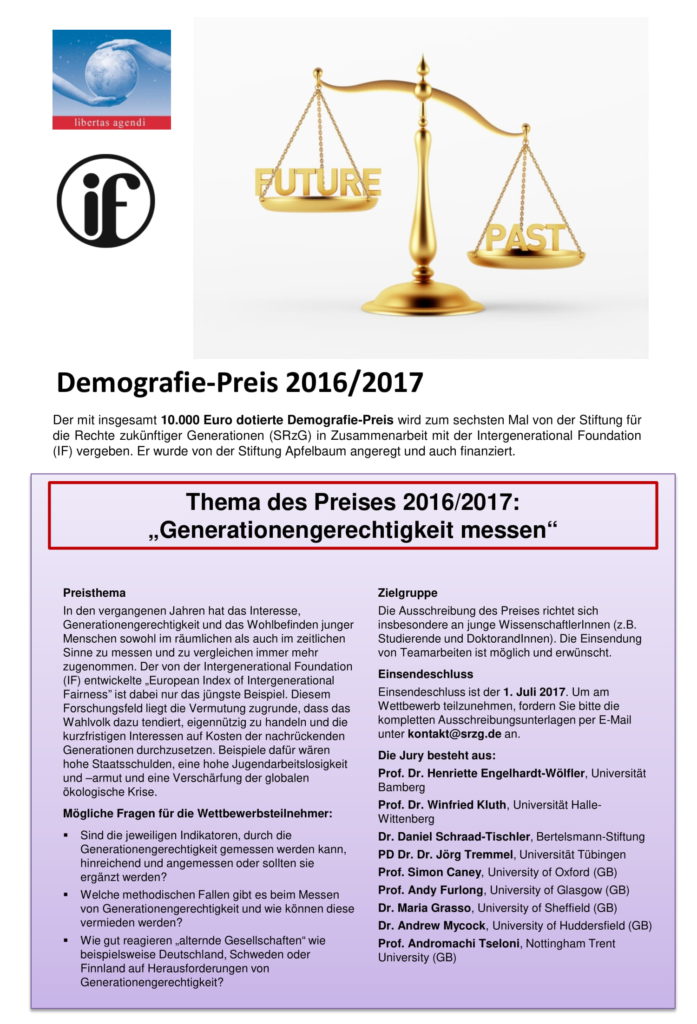
Der Demografie-Preis 2016/17 befasste sich mit dem Thema „Generationengerechtigkeit messen“.
Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Generationengerechtigkeit anhand geeigneter Maßzahlen und Indizes gemessen werden kann. Die eingereichten Wettbewerbsbeiträge befassten sich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der Messung von Generationengerechtigkeit. Zwar hat in den letzten Jahren das Interesse, Lebensqualität und Wohlbefinden allgemein zu messen, immer mehr zugenommen. In welchen Ländern allerdings speziell junge Menschen die besten Lebensbedingungen vorfinden, und worin diese bestehen, wird noch nicht erforscht.
Die Preisträger:innen 2017
Alle eingereichten Arbeiten wurden von einer hochrangigen unabhängigen Jury bewertet.
Die Siegerarbeiten wurden in den Ausgaben 2-2017 und 1-2018 der Intergenerational Justice Review veröffentlicht.
1. Preis:
Jamie McQuilkin: „Doing justice to the future: a global index of intergenerational solidarity derived from national statistics“
Den 3. Preis teilten sich zwei Arbeitsgruppen:
Natalie Laub und Christian Hagist: „Pension and Intergenerational Balance – A case study of Norway, Poland and Germany using Generational Accounting“
Bernhard Hammer, Lili Vargha und Tanja Istenic: „The Broken Generational Contract in Europe: Generous transfers to the elderly population, low investments in children “
Demografiepreis 2014/15:
„Geringe Wahlbeteiligung junger Menschen – Auswirkungen und Abhilfen"
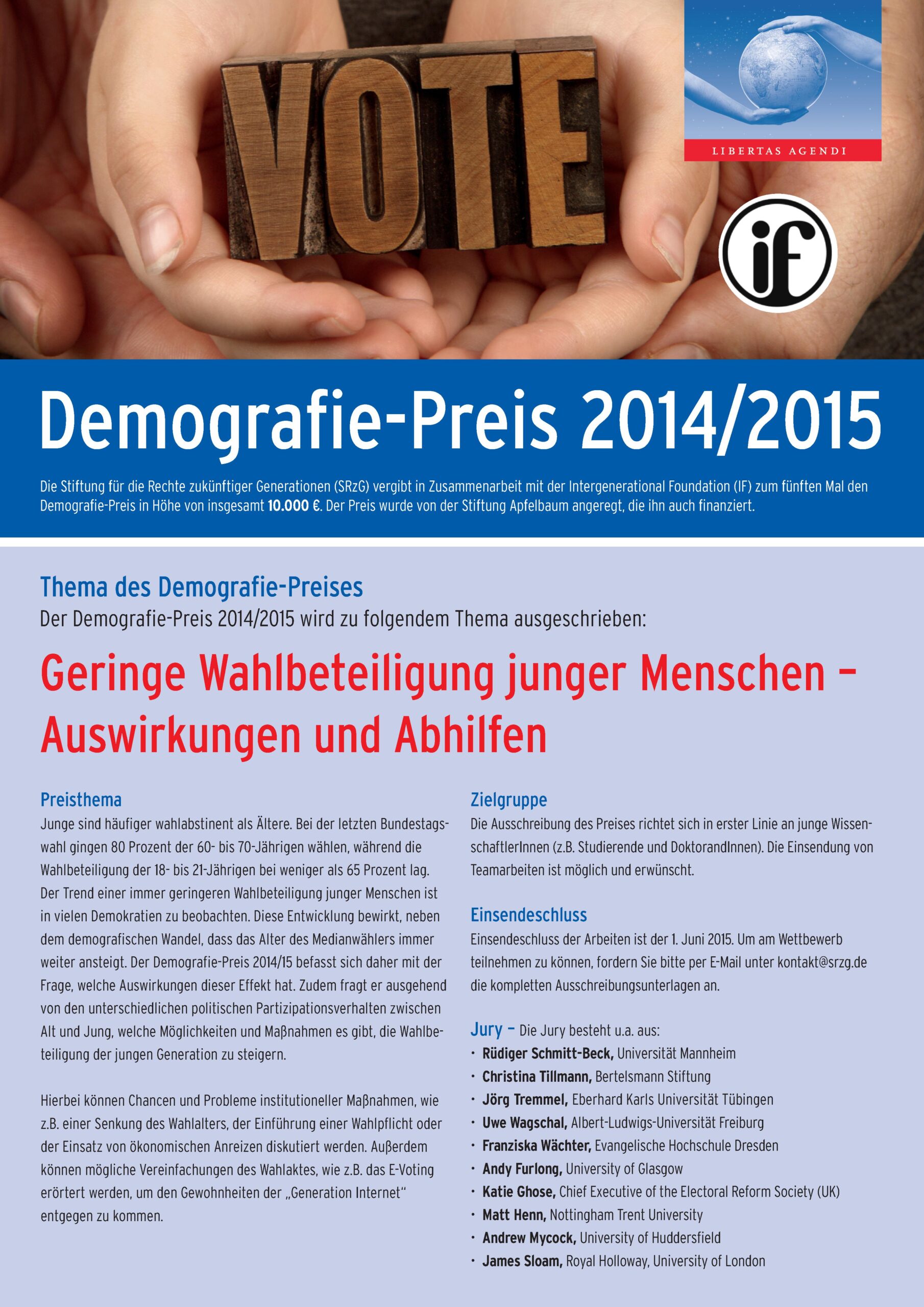
In vielen Demokratien gehen ältere Menschen häufiger zur Wahl als jüngere. In Deutschland ist die Wahlbeteiligung jüngerer Wählerinnen bei einem allgemeinen Rückgang besonders stark gesunken. Bei der Bundestagswahl 2013 lag die durchschnittliche Beteiligung bei 72,4 Prozent – ältere Wählerinnen lagen darüber, jüngere darunter. Die 60- bis 70-Jährigen wiesen mit knapp 80 Prozent die höchste Beteiligung auf, während die 18- bis 21-Jährigen über 15 Prozentpunkte darunter lagen.
Für die Parteien steigt dadurch das Medianwähleralter deutlich an, insbesondere in den neuen Bundesländern, wo der demografische Wandel stärker wirkt. Bei der Landtagswahl 2011 lag in Berlin das Medianalter der CDU-Wähler bereits bei über 60 Jahren. Auch bei den Parteimitgliedern ist das Durchschnittsalter hoch – bei CDU, SPD und Linken liegt es über 61 Jahren.
Kurzum: Die Wahlbeteiligung unterscheidet sich nach Lebensalter, wobei Alters- und Generationeneffekte zu unterscheiden sind. Letztere gehen davon aus, dass politische Teilhabe erlernt wird – je früher das Wahlrecht, desto höher die langfristige Beteiligung. Eingereichte Wettbewerbsbeiträge thematisierten mögliche institutionelle Maßnahmen zur Senkung des Medianwähleralters.
Die Preisträger:innen 2015
Die Siegerarbeiten wurden in der Ausgabe 1/2012 der Intergenerational Justice Review veröffentlicht.
Alle eingereichten Arbeiten wurden von einer hochrangigen unabhängigen Jury bewertet.
1. Preis:
Charlotte Snelling: „“School’s out!” A Test of Education’s Turnout-Raising Potential“
2. Preis:
Thomas Tozer: „Increasing electoral turnout among the young: Compulsory Voting or Financial Incentives?“
3. Preis:
Jonas Israel und Maximilian Brenker: „Mobilisierung von Jungwählern durch kommunale Online-Wahlhilfen – Eine empirische Untersuchung anhand des lokal-o-mat“
Preisverleihung und Symposium:
Die Preisverleihung fand am 8. September 2015 im Rahmen des 10. Demografie-Kongresses des BehördenSpiegel im dbb forum Berlin statt. Die Laudatio hielt Doris Wagner, demografiepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Demografiepreis 2012/13:
"Jugendquoten – eine Antwort auf die Alterung der Gesellschaft?"
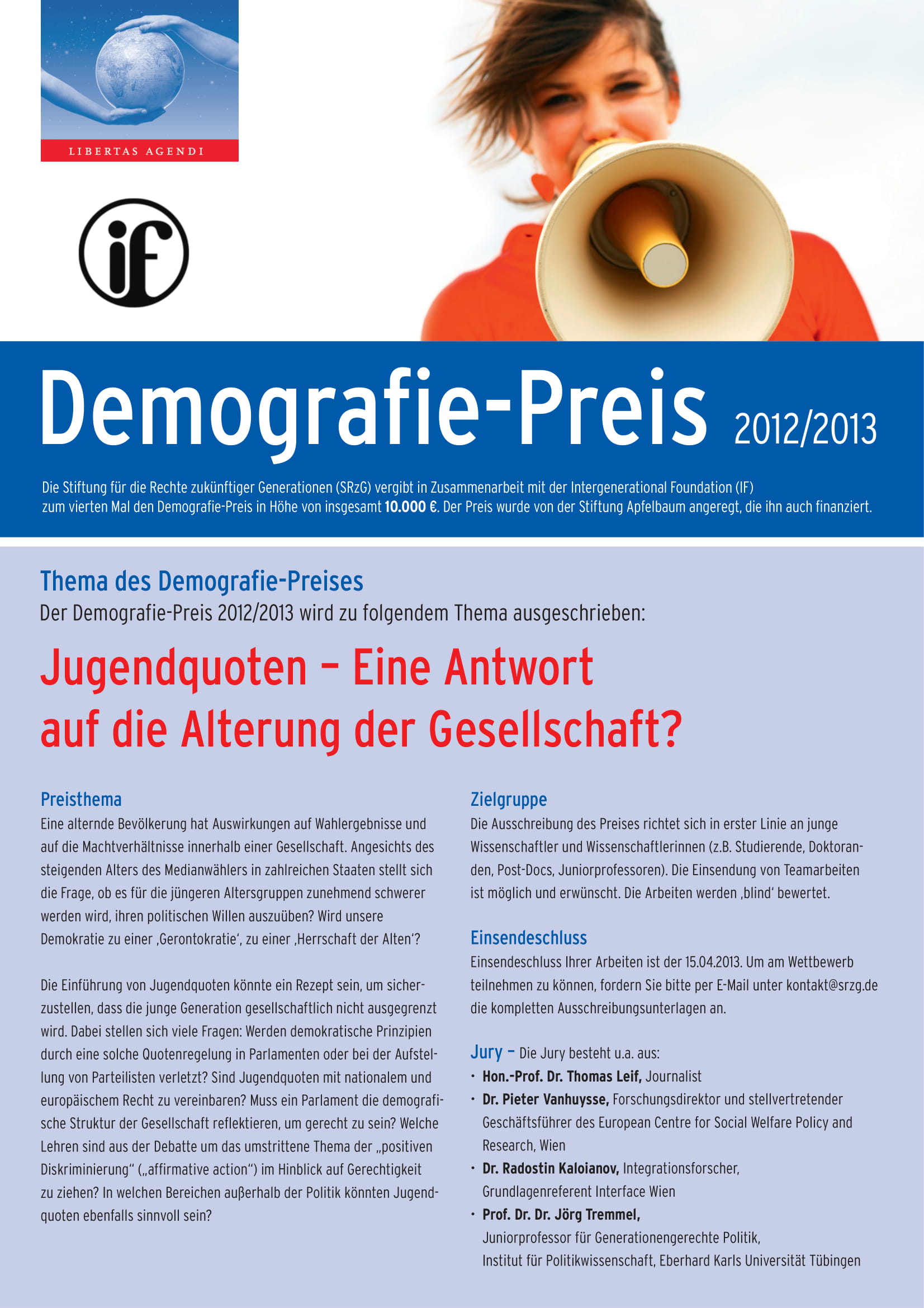
Der Demografie-Preis 2012/13 beschäftigte sich mit Jugendquoten. Der demografische Wandel hat in vielen Industrie- und Entwicklungsländern eine alternde Gesellschaft zur Folge. In Großbritannien wird laut Statistiken der Bevölkerungsanteil der über 84-Jährigen bis 2050 mehr als doppelt so hoch sein wie heute, während der Anteil der 16- bis 64-Jährigen sinkt. Ähnliche Tendenzen sind in ganz Europa zu beobachten.Die Auswirkungen auf die Repräsentation junger Menschen sind enorm. Die Einführung von Jugendquoten könnte eine Maßnahme sein, um dem Trend entgegenzuwirken und sicherzustellen, dass die junge Generation gesellschaftlich nicht ausgegrenzt wird. Durch Jugendquoten wird ein bestimmter Prozentsatz bestimmt, in dem junge Leute in einem Ausschuss oder Vorstand vertreten sein müssen. Im Kontext dieser Debatte werden Fragen an mehrere wissenschaftliche Disziplinen aufgeworfen. Aus politikwissenschaftlicher Sicht stellt sich etwa die Frage, ob Jugendquoten den Einfluss junger Leute auf Entscheidungsfindungsprozesse tatsächlich erhöhen oder aber, ob demokratische Prinzipien durch eine Quotenregelung in Parlamenten verletzt würden. Auch philosophische Fragen stellen sich: Muss ein Parlament die demografische Struktur einer Gesellschaft reflektieren, um gerecht zu sein?
Die Preisträger:innen 2013
Die Siegerarbeiten wurden in der Ausgabe 2/2014 des Journals für Generationengerechtigkeit veröffentlicht.
1. Preis:
Juliana Bidadanure: „Better Procedures For Fairer Outcomes: Are Youth Quotas Required by Intergenerational Justice?“
2. Preis:
Fatema Jahan: „Youth Quotas and Youth-i-zation Or Youth Leadership and Youth Movement? – A response to age demographics“
Den 3. Preis teilten sich:
Tobias Hainz: „Sind Jugendquoten eine Form der Altersdiskriminierung?“
Elias Naumann, Moritz Heß und Leander Steinkopf: „Der Generationenkonflikt in Europa. Die Jugendquote: von den Europäern gewollt?“
Preisverleihung und Symposium:
Die Siegerarbeiten wurden am 25/26. Oktober 2013 im Rahmen des internationalen wissenschaftlichen Symposiums „Youth Quotas – The Answer to Changes in Age Demographics?“ in Stuttgart prämiert. Die Veranstaltung fand in englischer Sprache statt und wurde von der Stiftung Apfelbaum, der Fritz Thyssen Stiftung und ENRI-Future gefördert.
Eine auführliche Dokumentation des Symposiums finden Sie in der Ausgabe 2/2015 der Intergenerational Justice Review. Mehr Informationen zu den Diskussionen sind hier zusammengefasst.
Demografiepreis 2010/11:
„Mehr Alte – wenige Junge: Wo ist eine Machtverschiebung zwischen den Generationen schon heute sichtbar und wie kann sie ausgeglichen werden?“

Der Demografie-Preis 2010/11 thematisierte die Alterung der Bevölkerung und die daraus resultierende Machtverschiebung:
Seit langem zeichnet sich der demografische Wandel klar ab: Wir werden weniger und älter. Die aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes kommt für Deutschland zu dem Ergebnis, dass die Bevölkerung bis 2060 auf 65 Millionen Menschen zurückgehen wird. Jeder Dritte wird über 65 Jahre und nur noch etwa jeder Sechste unter 20 Jahre alt sein; heute leben noch ungefähr gleich viele unter 20-Jährige und über 65-Jährige in Deutschland.
Bereits 2008 warnte der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog vor einer „Rentnerdemokratie“, um auf die Problematik von immer mehr älteren Wählern hinzuweisen. Aber könnte aus der deutschen Demokratie tatsächlich eine „Gerontokratie“ werden, in der die Jungen nichts mehr zu sagen haben? Der Demografiepreis 2010/11 fragte nach Antworten: Werden Wahlen und Wahlkämpfe durch den demografischen Wandel beeinflusst? Auch in den Parteien stellt sich die Frage, ob und wie sich die Alterung in ihren Programmen und Parteigremien abzeichnet. Gesucht werden innovative Lösungsvorschläge, die das Potenzial haben, eine politische Debatte anzustoßen.
Die Preisträger:innen 2011
Die Siegerarbeiten wurden in der Ausgabe 1/2012 des Journals für Generationengerechtigkeit veröffentlicht.
1. Preis:
Bettina Munimus (Universität Kassel): „Von einer quantitativen Mehrheit zur qualitativen Macht? Ein Untersuchung der Interessenvertreter der älteren Generation“
2. Preis:
Cornelia Wiethaler (Universität Heidelberg): „Die Idee der Gerechtigkeit nach Amartya Sen in der Anwendung auf das deutsche Sozialsystem – drei Skizzen für ein lokales Verantwortungsmodell“
Preisverleihung und Symposium:
Anlässlich der Verleihung des Demografie-Preises fand am 16. Januar 2012 ein Symposium in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin statt. In Workshops und Podien wurde diskutiert, mit welchen Strategien Politik, Gesellschaft und Wirtschaft auf die neuen Mehrheitsverhältnisse reagieren können. Über 70 Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft und interessierter Öffentlichkeit beteiligten sich an der Veranstaltung, darunter Nadine Schön (MdB CDU), Franz Müntefering (MdB SPD), Michael Stage (future! Die junge Alternative) und Harald Wilkoszewski (OECD). Die Thesen und Vorschläge der Preisträgerinnen wurden Ausgangspunkt von kontroversen Diskussionen in Fachgruppen und auf dem Podium. Auch bestehende Reformansätze der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, wie das Wahlrecht ohne Altersgrenze, wurden im Lichte neuer Erkenntnisse aufgegriffen und debattiert. Die Veranstaltung wurde gefördert und ermöglicht durch die Robert-Bosch-Stiftung.
Demografiepreis 2008/09:
„ Wie können Chancen für junge Menschen in schrumpfenden Regionen aktiviert werden?“

Der Demografie-Preis 2008/09 thematisierte das Schrumpfen von Regionen.
Der demografische Wandel, also die Alterung und Schrumpfung unserer Gesellschaft, ist kein neues Thema. Bevölkerungswissenschaftler und Statistiker haben bereits seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen Wandel der Bevölkerungsstruktur erfasst und einen Bevölkerungsschwund vorhergesagt. Der empirische Befund scheint eindeutig: Seit 1972 liegt die Zahl der Geburten in der Bundesrepublik unter der Zahl der Todesfälle. Bevölkerungszuwächse wurden seither lediglich durch Einwanderung realisiert. Obgleich demografische Veränderungen schon seit mehr als dreißig Jahren beobachtet werden können, hat das Thema in der öffentlichen Debatte ein erstaunliches Schattendasein geführt. Politische Entscheidungsträger haben sich damit erst spät befasst, nämlich in den 90er Jahren und zwar vor allem mit dem Aspekt der Alterung, der in das Zentrum der Diskussion geraten ist. In vielen Lebensbereichen hält die schrumpfende Gesellschaft neue Herausforderungen bereit. Aber gerade weil die Schrumpfung ein Abrücken von den bekannten Vorstellungen einer wachsenden Gesellschaft verlangt, eröffnet sie auch neue Chancen, Perspektiven und Handlungsoptionen. Sie zu realisieren, ist unsere wichtigste Zukunftsaufgabe.
Die Preisträger:innen 2009
1. Preis:
Felix Kroh: „Möglichkeiten und Chancen junger Menschen in schrumpfenden Städten“
2. Preis:
Karsten Bär, Anja Erdmann und Corinna Hamann: „Verschwend‘ nicht deine Jugend“
Hier lesen
Sonderpreis:
Maya Rocak und Maurice Hermans: „Zachte G: a modern approach towards building networks for young people in a shrinking region“
Video „shrinkage and creative thinking“
Preisverleihung und Symposium:
Am 5. März 2010 wurde der 2. Demografie-Preis im Rahmen eines Symposiums mit dem Titel „Wo bleibt die Jugend? Chancen in schrumpfenden Regionen nutzen“ in Berlin verliehen. Das Symposium wurde in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei Brandenburg organisiert und fand in der Landesvertretung Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns in Berlin statt. Im Rahmen der Veranstaltung stellten die Preisträger ihre Arbeiten vor, im Anschluss fand eine Diskussion zu den Möglichkeiten Jugendlicher in schrumpfenden Regionen statt. Einig waren sich die über 60 Teilnehmer, dass der Jugend eine Schlüsselstellung bei der Gestaltung der Chancen des demografischen Wandels zufällt.
Mehr Informationen zur Preisverleihung in der Dokumentation und im Flyer.
Demografiepreis 2006/07:
„ Wege zu mehr Kindern in Deutschland unter den Rahmenbedingungen einer liberalen Gesellschaftsordnung“

Der Demografiepreis 2006/07 der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen suchte nach Arbeiten von Nachwuchswissenschaftlern zum Geburtenrückgang in Deutschland. Inwieweit ist es möglich, die Gesamtfertilitätsrate in Deutschland zu steigern? Lassen sich aus den höheren Gesamtfertilitätsraten anderer entwickelter Länder konkrete Handlungsempfehlungen ableiten? Die Bevölkerung in Deutschland wird älter werden und schrumpfen. Dieser demografische Wandel ist nicht mehr aufzuhalten. Daher ist die Wissenschaft aufgerufen, Chancen und Risiken dieser Entwicklung zu benennen und Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Handlungsoptionen aufzuzeigen. Die Spirale von Alterung und Schrumpfung wird sich weiter verstärken, wenn ihrer Ursache, dem Geburtenrückgang, zu wenig entgegengesetzt wird. Um den Forschungsrückstand zu verringern, schrieb das SRzG-Institut idz den Demografie-Preis zum Thema „Wege zu mehr Kindern in Deutschland unter den Rahmenbedingungen einer liberalen Gesellschaftsordnung“ aus. Die in Deutschland betriebene Bevölkerungswissenschaft hat – auch aus historischen Gründen – in den letzten 60 Jahren die Determinanten der Fertilität weniger untersucht als andere Faktoren. Durch verstärkte Forschung könnte auch der Wissensstand von Publizisten und der Allgemeinbevölkerung verbessert werden.
Die Preisträger:innen 2007
Die Siegerarbeiten wurden in der Ausgabe 3/2007 des Journals für Generationengerechtigkeit veröffentlicht.
1. Platz:
Franziska Höring, Jan Lemanski, Stephan Schütze und Christoph Sperfeldt: „Changing minds and politics“
2. Platz:
Wolfgang Gründinger: „Mehr Kinder wagen“
Hier lesen
Den 3. Platz teilten sich:
Inés Brock: „Geschwisterlosigkeit und wie der Mut zur Mehrkinderfamilie geweckt werden kann“
Hier lesen
Annelene Wengler und Anne-Kristin Kuhnt: „Kinder, Kinder, Kinder“
Sonderpreis:
Susanne Mey für „Die Krise als Chance zur Veränderung“
Hier lesen
Preisverleihung und Symposium:
Die Preisverleihung fand am 9. November 2007 in der Sächsischen Landesvertretung in Berlin statt, in Kooperation mit dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) und dem Inforadio Berlin, welches auch Teile der Veranstaltung im Radio übertrug.
Mehr Informationen zum Programm im Flyer.
